| |
Kapitel 4 Psychologische Theorien zur Luzidität |
| 4.1) Die Dualität des Denkens im luziden Traum nach PRICE & COHEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das luzide Träumen wird von PRICE & COHEN in den Kontext von Träumen und Bewußtsein eingebettet, wobei von einem Dualismus gedanklicher Prozesse ausgehend, der ebenfalls duale Zustand des luziden Träumens besprochen wird. Die meisten Träume werden durch eine akzeptierende, kritiklose Haltung des Träumers ohne Reflexion des Trauminhalts, mag er auch noch so bizarr sein, charakterisiert, die RECHTSCHAFFEN "Single-mindedness" nannte. Einen möglichen Erklärungsansatz für die "Single-mindedness" sehen PRICE & COHEN in dem Ansatz, daß das menschliche Gehirn imstande ist, zwei qualitativ verschiedene Arten von Denkprozessen hervorzubringen. Dabei berufen sie sich auf KLINGER, der die Termini "operantes" und "respondentes" Denken einführte. Operantes Denken (OD) beinhaltet bewußt gesteuerte Aufmerksamkeitslenkung, die von den Regeln der Logik und den Gesetzen der Realität geleitet werden. Im Gegensatz dazu wird das respondente Denken (RD) als halluzinatorische Wahrnehmung, z.B. als Tagtraum oder Traum, erfahren und wird von unbewußten Prozessen gespeist. Doch lassen wir KLINGER selbst zu Wort kommen:"In very general terms, operant thinking appears to differ from respondent thinking in that it is accompanied by a sense of volition, is checked against feedback concerning its effects, is evaluated according to its effectiveness in advancing particular goals, and is protected from drift and distraction by the thinker`s deliberately controlling his or her attention." Diese Unterscheidung diente COHEN & PRICE als Grundlage für ihr Modell vom luziden Träumen. Das Verhältnis von OD und RD soll zunächst am Beispiel des Lesens illustriert werden. Während des Lesens (OD) ist es nicht ungewöhnlich eventuell mehrmals kurz in Tagträume (RD) wegzugleiten, gerade dann, wenn man schläfrig oder unmotiviert ist, auch wenn man formal noch weiterlesen sollte. Zwei alternative Hypothesen würden diese Unterbrechung des OD erklären. Die erste besagt, daß OD und RD alternieren, nur ein Modus kann zur gleichen Zeit aktiv sein, so daß man von einer Denkart in die andere umgeschaltet wird. Die zweite Hypothese, auf die im folgenden aufgebaut werden wird, besagt, daß das RD permanent aktiviert ist, während das OD nur periodisch aktiviert wird. Damit maskiert das OD das RD mit bewußter Aufmerksamkeit, daß nun außerhalb der bewußten Aufmerksamkeit weiterarbeitet. Hierbei wird das RD als Baselineprozeß betrachtet, als Bewußtseinsstrom, der sowohl im Schlaf wie im Wachen fortdauert. Der RD-Fluß aktiviert assoziierte Gedächtnisinhalte und affektive Reaktionen und ergänzt das OD. Wird nun die zweite Erklärungsmöglichkeit auf das Lesebeispiel angewandt, heißt das, daß das OD etwa durch Müdigkeit seinen Halt im Bewußtsein verliert, mit der Konsequenz, daß das RD immer stärker wird, bis es ins Bewußtsein dringt. Auf unsere Träume angewandt, heißt dies, daß sie eigentlich immer da sind, genauso wie die Sterne am Himmel, die aber tagsüber nicht sichtbar sind, da das Sonnenlicht sie überstrahlt. Nachts im Traum haben wir also die Möglichkeit für einige Zeit am Datenstrom, den unser Gehirn permanent produziert, teilzuhaben. Die Autoren gehen davon aus, daß des Träumers Grad an Bewußtsein und Selbstreflexion auf einem Kontinuum fluktuiert. Obwohl Träume primär Kreationen des RD sind, beinhalten manche das Auftauchen des OD, z.B. bei präluziden Träumen, wenn der Träumer die Realität eines bizarren Traumelementes hinterfragt. Im luziden Traumzustand wird die duale Natur des menschlichen Denkens noch offensichtlicher. Sobald man zweifelsfrei erkannt hat, daß man gerade träumt, wird diese Erkenntnis in der Regel von einem diskreten phänomenologischen Übergang in einen qualitativ, vom gewöhnlichen Traum verschiedenen, Bewußtseinszustand begleitet, eben durch die plötzliche Aktivierung des OD. Nun steht es dem Träumer frei, die sich entfaltenden RD-Produkte zu beobachten und sich gegebenenfalls darüber zu wundern. Aber auch der OD-Anteil während eines Klartraums scheint zu fluktuieren. So hält ein Klarträumer Traumgestalten oder Traumobjekte manchmal für real und hebt sich im Traum z.B. ein Brötchen auf, welches er nach dem Erwachen essen will. Der Klarträumer mag versuchen, den Verlauf oder Inhalt des Traums zu manipulieren, aber diese Anstrengungen werden meist begrenzt und unvorhersagbar bleiben. Auch wenn man mehr Übung im Umgang mit dem Klartraum hat und dadurch die Kontrolle vollständiger wird, hat der RD Traumgenerator das letzte Wort, die oberste Kontrolle über den weiteren Verlauf. Die Natur des OD könnte einen Traum nie in seiner vollen halluzinatorischen Komplexität generieren, das OD im Traum ist auf das Beobachten und Modifizieren des RD begrenzt. Der luzide Träumer wandert auf einem schmalen Grad zwischen normalen Traum und Erwachen. Zu wenig an OD wird nach PRICE & COHEN dazu führen, daß der Klarträumer in den nicht luziden Traum zurückfällt. Zu viel OD unterbricht den Klartraum, er entgleitet, genauso wie die plötzliche Bewußtheit eines Tagtraumes denselbigen beendet. Gerade beim Beginn einer luziden Episode besteht die Gefahr einer Überaktivation des OD, was zum Erwachen führt. Da es schwierig ist, das OD während des Schlafes zu aktivieren und dann zu regulieren, stellt luzides Träumen in der Realität eher die Ausnahme denn die Regel des Traumgeschehens dar. PRICE & COHEN unterscheiden nun nochmals zwei Subformen von OD, nämlich aktive und passive Aspekte; beide tragen dazu bei, daß Klarträume entstehen, sich stabilisieren und weiterentwickeln können. Die Initiation des sich entfaltenden Klartraumes benötigt beide Aspekte. Einerseits muß die Traumumgebung fokussiert werden (rezeptives OD), andererseits muß die kritische Frage gestellt werden, ob man nun träumt (aktives OD). Eine vom Träumer durchgeführte Realitätsprüfung im Traum zählt ebenfalls zum aktiven OD. Sobald sich der luzide Zustand stabilisieren konnte, erlaubt das passive OD den Traum (RD) zu beobachten, während das aktive OD zur Traumsteuerung eingesetzt werden kann. | ||||||
| 4.2) Das Pyramidenmodell der Träume nach HUNT | ||||||
|
HUNT beschreibt die Integration des luziden Traums in die Vielfalt der Traumformen, wobei er aus phänomenologischer Sicht kultur- und zeitübergreifende Übereinstimmungen bzgl. der Beschreibungen von Traumformen gefunden hat. Nach HUNT berichten alle Kulturen über den gewöhnlichen Traum, der auf einer Reorganisation von Erinnerungen zu basieren scheint. Die meisten Kulturen berichten außerdem über den mystisch-archetypischen Traum, wie JUNG ihn nannte. Diese Traumform wurde gerade in ursprünglichen und stammesartigen Gesellschaften hoch angesehen. Bei diesen Träumen berührt man im subjektiven Erleben eine heilige Sphäre, möglicherweise trifft man ehrfurchtgebietende archetypische Wesenheiten. Anthropologisch gesehen trugen diese Träume in etlichen Gesellschaften zur Erhaltung und Erneuerung der Kultur bei, indem sie als Quelle von mystischen Überlieferungen fungierten. Eine weiter Form ist der Alptraum, wo der Träumer meist angstvoll miterleben muß, wie er z.B. von seltsamen Wesen verfolgt wird oder sonstige traumatische Situationen durchleben muß. Außerdem lassen sich Beschreibungen von Heilträumen finden, die den körperlichen Zustand in positiver Weise zu beeinflussen vermögen, telepathische Träume, sowie Tagträume. Aber auch das luzide Träumen findet Erwähnung in historischen Quellen verschiedener Kulturen. HUNT bietet nun ein umgekehrt pyramidenförmiges Modell an (Abbildung 2), daß die wesentlichen Traumformen integriert und auf 2 Dimensionen anordnet. Die vertikale Dimension beschreibt die Lebhaftigkeit oder Intensivierung des Traums. Bei minimaler Ausprägung der Lebhaftigkeit (am Boden des Modells) befinden sich die Träume, die vorwiegend realistisch sind und eher undeutlich erscheinen. Bei Zunahme der Lebhaftigkeit der Träume nimmt auch deren Deutlichkeit, die emotionale Beteiligung und deren Bizarrheit zu. Diese Träume sind am häufigsten und können am besten als Reorganisationen von Erinnerungen begriffen werden. Das gewöhnliche Träumen (untere Hälfte, Abb 2) repräsentiert die Integration des semantischen Gedächtnisses und der Sprache in den Traumprozeß, wobei der diffusen Gedächtnisaktivierung eine narrative Struktur gegeben wird. Bei weiterer Intensivierung des Traumprozesses (weiter oben im Modell) lassen sich dann komplexe Erzählungen, Heilträume, metaphorische Traumberichte, telepathische Träume und Problemlösen im Traum finden. An der Spitze des Modells befindet sich der Alptraum, der luzide Traum und der mystisch-archetypische Traum. Es existiert ein hypothetischer Punkt auf der y-Achse, ab welchem das Konstrukt Traum, als primär aus Erinnerungen gespeister Vorgang, unzureichend erscheint, und man auf Modelle kreativer Imagination zurückgreifen muß, um die Transformationen des Traumprozesses zu verstehen. Die horizontale Dimension beschreibt die Spanne an symbolischem Gehalt oder symbolischer Differenzierung unter den Traumformen. Je stärker der Symbolismus, desto mehr öffnet sich die Pyramide. Bei maximaler symbolischer Differenzierung lassen sich Träume finden, die stark von kreativen bildhaften Vorstellungen geprägt werden, telepathische Träume oder etwa das Problemlösen im Traum. HUNT unterteilt die symbolische Dimension außerdem noch nach Erzählstruktur (story), Handlungen (action), Wahrnehmungen (observation) und Handlungsort (setting), welche die "Ecken" der Pyramide markieren. Nach HUNT sind luzide und archetypische Träume Formen intensivierter Träume, die sich, begünstigt durch ein gut ausgeprägtes visuell-räumliches Vorstellungsvermögen durch Übung stabilisieren konnten, während er Alpträume als destabilisierte visuelle Intensivierungen ansieht. Abbildung 2 soll das gerade gesagte verdeutlichen, man berücksichtige, daß man sich das Modell dreidimensional (zusammengefaltet) vorstellen sollte. 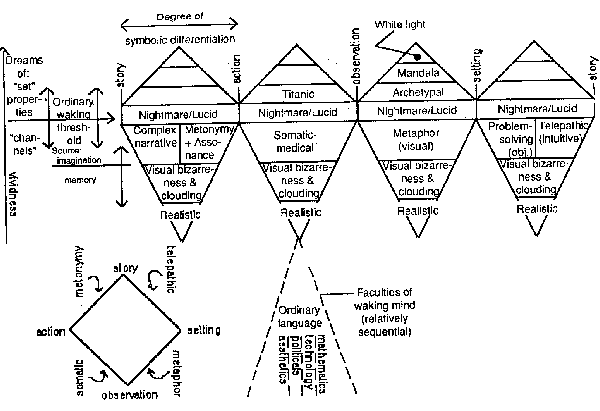 Abbildung 2: Das Pyramidenmodell nach HUNT (1988). Die Y-Achse bezeichnet die Lebhaftigkeit der Träume, die X-Achse das Ausmaß an symbolischem Gehalt. Erläuterungen siehe Text. Beim luziden Traum ist vor allem die Fähigkeit zur Selbstreflexion stark erhöht (häufig empfindet man auch Euphorie), Alpträume sind Ergebnis emotionaler und kinästhetischer Intensivierung und mystisch-archetypische Träume sind Ausdruck einer gesteigerten Tätigkeit des visuellen Vorstellens, welche den gesamten Lebenskontext zu vergegenwärtigen vermag. Aufgrund der intensiven Erlebnisse befinden sich diese Formen nahe am Übergangsstadium zum Erwachen, was im Pyramidenmodell berücksichtigt wird. Die Pyramide zeigt auch, daß sowohl luzides Träumen als auch Alpträume sich in einen mystisch-archetypischen Traum umwandeln können (diese Formen liegen auf derselben Ebene des Modells). Relativ häufig stellen alptraumhafte Situationen den Beginn einer luziden Episode dar, wenn der Träumer sich z.B. denkt: "Mein Gott, das kann doch gar nicht passieren. Ich muß träumen." Sowohl luzide als auch archetypische Träume können sich inhaltlich in Wahrnehmungen von geometrischen Formen (vgl. CASTANEDA, 1998), Mandalas oder von weißem Licht weiterentwickeln, deren Beschreibungen man auch in drogeninduzierten Bewußtseinzuständen, tiefer Meditation oder sensorischer Deprivation finden kann. So kann man luzide Träume auch als Meditation während des Traums bezeichnen. Meditative Zustände haben mit luziden Träumen eine entscheidende Gemeinsamkeit: das Bewußtsein ist in ein Thema involviert, während gleichzeitig ein Teil des Geistes diese Tätigkeiten beobachtet. | ||||||
| 4.3) Luzides Träumen als mentale Repräsentation des "Wach-Selbst" im Schlaf nach BLACKMORE | ||||||
|
Einen informationsverarbeiteten Ansatz des Klarträumens liefert BLACKMORE. Ausgehend von der Position der alternativen Realitätskonstruktion, d.h. es gibt keine objektive Realität, sondern Ereignisse werden konstruiert bzw. interpretiert, wird dieses Modell von dem Wachzustand auf den Traum und weiter auf den Klartraum angewandt. Eine wesentliche Aufgabe des kognitiven Systems ist es, Repräsentationen unserer Umwelt und unseres Selbst darin zu konstruieren. Zum einen wird eine mentale Repräsentation der Umwelt aufgrund von vorherigen Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert, so daß man Ereignisse antizipieren kann, indem man ihre Reproduktion konstruiert. Andererseits kann die gespeicherte Repräsentation der Welt modifiziert werden, wenn neue Informationen eintreffen, die mit dem alten Modell nicht übereinstimmen. Gedächtnis- und Wahrnehmungsprozesse können nach BLACKMORE nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da das Gedächtnis die Wahrnehmung beeinflußt, z.B. über Erwartung. Das Modell von der Umwelt beinhaltet ebenfalls Repräsentation unseres Selbst darin, so daß man beide zu einem Modell der Realität zusammenfassen kann. BLACKMORE betont außerdem, daß ein Mensch bei der bildlichen Vorstellung einer Szene, indem er sie aus dem Gedächtnis abruft, diese auf verschiedene Weisen konstruieren kann, die er in der Realität so nicht wahrgenommen hat. Beispielsweise wird eine Szene aus der Vogelperspektive imaginiert oder man integriert sich selbst in das Bild, d.h der Originalinput wird transformiert. Zentral für BLACKMOREs Theorie ist, daß wir fortwährend eine Repräsentation der Realität konstruieren, wobei ein Modell, von mehreren gleichzeitig im Gehirn entwickelten Alternativen, präferiert wird. Je nachdem, welches Gewicht internen und externen Informationsquellen eingeräumt wird, wird ein Modell ausgewählt, wobei die Entscheidung darüber, welches Modell sich durchsetzt, erst relativ spät im Informationsverarbeitungsfluß gefällt wird. Es setzt sich aber immer nur ein Modell durch, oder anders ausgedrückt, es gibt immer nur eine subjektive Realität. Während mehrere Modelle möglich sind, bestimmt die "Stabilität" einer Repräsentation, welches als aktuelle Version der Realität dominiert. Dies ist abhängig von Fluktuationen in der Strenge des Kriteriums, Inkonsistenzen zwischen dem aktuellen Modell und neuer Information zuzulassen. Ein strenges Kriterium akzeptiert weniger Ungereimtheiten und erfordert häufigere Anpassung an die neue Information, wie es im aufmerksamen Wachzustand die Regel ist. Bei einem lascheren Kriterium, z.B. bei geringer Aufmerksamkeit, Ablenkung oder Übermüdung, werden größere Diskrepanzen akzeptiert, ohne das Modell zu modifizieren. Welche Repräsentation dominiert und somit als Realität angesehen wird, läßt sich nach BLACKMORE als eine Funktion der Aktiviertheit (arousal), die von geringerer (Schlaf) bis größerer (Wachzustand) Verarbeitungskapazität reicht, und des sensorischen Input (extern wie intern) definieren. Der Schlaf stellt somit einen veränderten Bewußtseinszustand mit reduziertem Arousal und schwachem Kriterium dar, so daß große Inkongruenzen akzeptiert werden. Des weiteren verlagert sich das Modell im Schlaf von sensorischem zu internem Input. Betrachtet man den Einschlafvorgang, fällt sowohl das Arousal als auch der sensorische Input stetig ab. Das ursprüngliche Realitätsmodell wird immer weniger von sensorischem Input dominiert, so daß interne Quellen zeitweilig Realitätsstatus gewinnen können und sich beispielsweise in hypnagogen Bildern ausdrücken können (Schlaf-Stadium 1). Fällt man nun in den NREM-Schlaf, werden Input-kontrollierte Modelle minimiert, auch bzgl. interner Speisung. Dies zeigt sich darin, daß bei Weckungen aus dieser Schlafphase seltener Traumberichte berichtet werden und diese eher Gedankenprozessen statt bildhaften Träumen gleichen. Im REM-Schlaf nimmt das Arousal wieder zu, genug Kapazität wird frei, um Repräsentationen der Welt und des Selbst entstehen zu lassen, aber es wird kaum sensorischer Input produziert, so daß interne Quellen (Gedächtnismaterial, Imagination) diese Repräsentationen bestimmen. Und da dem dominanten Modell nach BLACKMORE immer Realitätsstatus zuerkannt wird, erscheinen uns die Träume realistisch trotz bizarrer Elemente. Allerdings ist im gewöhnlichen Traum der freie Zugang zum Gedächtnis stark eingeschränkt, möglicherweise aufgrund zu geringen Arousals. Schließlich weiß man in der Regel während des Traums nicht, wie man heißt, welches Datum ist oder daß man träumt. Es wird nur eine rudimentäre Repräsentanz des Selbst ausgebildet, das keine eigene Entscheidungsfreiheit hat. Unter bestimmten Umständen, z.B. bei bizarren Ereignissen, kommt dem Träumer die Idee, daß er träumen könnte. Allerdings besteht nicht die Möglichkeit, durch sensorischen Input zu validieren, ob man im Bett liegt und schläft. Meist wird dieser Gedanke wieder verworfen und man fällt von dem präluziden Traum wieder in den gewöhnlichen Traum zurück. Das Modell, welches beinhaltet zu wissen, daß man träumt und gleichzeitig schläft, kann sich aber dann als dominante Repräsentanz durchsetzen, wenn ausreichend Information aus dem Gedächtnis zugänglich ist und diese Information lange genug aktiviert bleibt, um Realitätsstatus zu erlangen. BLACKMORE weiter: "It can be seen that memory is crucial here in providing stability for the lucid model. If we suppose that the efficiency of memory is a function of arousal (at least at these low levels of arousal in sleep), then this theory would predict that lucid dreams will occur when arousal is relatively high" Das Modell des luziden Traums selbst ist aber instabil, d.h. es ist schwierig, dieses Realitätsmodell aufrechtzuerhalten, da der Traum versucht, das nun luzide Traum-Ich in irgendwelche Ereignisse zu involvieren. Darauffolgende Emotionen des Träumers können dann den Fortbestand des Luziditätsmodell gefährden. Die Folge ist der Rückfall in den normalen Traum, wodurch die Repräsentation des Selbsts sich verändert, denn der Klartraum unterscheidet sich vom gewöhnlichen Traum durch unterschiedliche Modelle des Selbst. Dazu BLACKMORE: "The reason I feel more conscious in my lucid dreams is because I, the mental model, have been constructed by the brain in such a way as to be more similar to my waking self. (...)And it´s all just a by-product of all that processing going on". | ||||||
| 4.4) Luzidität als kognitives Schema nach LaBERGE | ||||||
|
Obwohl LaBERGE einer der wichtigsten Erforscher des Klarträumens ist, hat er sich weniger um eine theoretische Einbettung des Phänomens bemüht (oder ich habe nichts gefunden). Hier sei nun versucht seine Sichtweise zu schildern. In Übereinstimmung mit BLACKMORE plaziert er Luzidität in eine informations-verarbeitenden Kontext. Das Träumen und das Klarträumen folgt den selben Gesetzmäßigkeiten, die den Wachzustand determinieren, insbesondere Wahrnehmung, Erwartung und Motivation. Für ihn sind Träume Repräsentationen der Welt, die das Gehirn konstruiert, indem bestimmte Schemata aktiviert werden, sofern sie die Wahrnehmungsschwelle überschreiten und ins Bewußtsein treten. Diese Schemata geben Träumen ihre Ordnung, ihre Gestalt. Im Traum luzide zu werden beruht nach LaBERGE einfach auf der Aktivierung des "Dies ist ein Traum-Schemas", das z.B. durch bizarre Traumelemente ausgelöst werden kann. Über dieses Schema wird dann die Inkongruenz dieser Elemente behoben, da man den Traum als solchen erkennt. Den Grund, warum die meisten Menschen keine luzide Träume haben, sieht er in einer konzeptuellen Barriere, dieses Schema zu aktivieren, so daß es oft einen Auslöser im Traum benötigt, um dieses Schema wahrscheinlicher zu machen. Es ist aber möglich, dieses spontan selten aktivierte Schema zu trainieren, und er hat dementsprechend verschiedene Induktionsmethoden entwickelt. | ||||||
| 4.5) Die kritisch-realistische Sichtweise des luziden Traums nach THOLEY | ||||||
|
THOLEYs gestalttheoretischer Standpunkt, namentlich der des kritischen Realismus, gründet auf der strengen Unterscheidung zwischen der physikalischen Welt, die sich in den physikalischen Organismus und die physikalische Umwelt unterteilen läßt, und der phänomenalen Welt, die sich in das phänomenale Körper-Ich und die phänomenale Umgebung gliedert. Das bedeutet, daß es ebenso viele phänomenale Welten gibt, wie es bewußtseinsbegabte Wesen gibt, aber nur eine transphänomenale (=physikalische) Welt. Als physiologisches Korrelat der phänomenalen Welt werden kortikale Prozesse im Psychophysischen Niveau (PPN) postuliert, einem hypothetisch angenommenen System verschiedener Großhirnbereiche, dem kein fester Ort zugeschrieben werden kann. Dort wird die Welt, inklusive den Wahrnehmungen unseres eigenen Körpers, repräsentiert. Im Wachzustand werden diese Prozesse, durch die aus den verschiedenen Sinnesgebieten stammenden sensorischen Erregungsmuster, derart bestimmt, daß die phänomenale Welt ein (mehr oder weniger getreues) Abbild der physikalischen Welt darstellt. Im Wachzustand werden Bewegungsabsichten über die Bildung motorischer Erregungsmuster in korrespondierende Bewegungen des Körpers umgesetzt. Indem eine Bewegung über Erregungsweiterleitung wiederum zum PPN rückgemeldet wird, stehen die phänomenale und physikalische Welt im Wachzustand in einem sensumotorischen Regelkreiszusammenhang. Im Traumzustand dagegen wird der sensumotorische Regelkreis aufgebrochen, so daß die phänomenale Welt kein Abbild mehr der physikalischen Welt darstellt und Bewegungsabsichten auch nicht in korrespondierende Bewegungen des physikalischen Organismus umgesetzt werden. Das bedeutet unter anderem, daß man im Traum seine transphänomenalen Grenzen (physikalische oder moralische) überschreiten kann und Dinge erleben, die im Wachzustand nicht möglich wären, da es vom Erleben her (phänomenologisch) keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Wacherleben und Traumerleben gibt. Weiter folgert THÓLEY: "Die Tatsache, daß es im Schlaf zu Traumerlebnissen kommt, die den Wacherlebnissen sehr ähnlich sein können - dies gilt für Klarträume in ganz besonderem Maß - ist nach der Isomorphieannahme der Gestalttheorie, die eine Strukturgleichheit von phänomenalen und kortikalen Vorgängen postuliert, so zu erklären, daß die PPN-Prozesse im Traumzustand denen im Wachzustand ähnlich sind; dabei sind die Ursachen für das Vorhandensein der kortikalen Vorgänge im Traumzustand noch weitgehend unbekannt." Vom kritischen Realismus aus gesehen, mit seiner postulierten "Verdopplung der Welt" in phänomenale und transphänomenale, ist nach THOLEY das Klarträumen gut erklärbar, da das Bewußtsein über die transphänomenalen Begebenheiten während eines Klartraums Priorität gegenüber den phänomenalen hat (oder anders gesagt, das Traum-Ich vergißt nicht das Schläfer-Ich). Der Klarträumer weiß, als kritischer Realist, daß alles, was einem Menschen unmittelbar erscheint, grundsätzlich immer Bestandteil seines eigenen Bewußtseins bzw. seiner eigenen phänomenalen Welt ist. Ebenso, wie man im Wachzustand über sensumotorische Regelkreise von dem PPN in die transphänomenale Welt eingreift, kann man vom Klartraumzustand aus über das PPN verändernd auf die innere Welt einwirken. Abbildung 3 verdeutlicht die sogenannte Verdoppelung der Welt.
THOLEY nennt vor allem das klinische Anwendungsgebiet, in denen das Klarträumen Verwendung finden sollte, etwa bei der Überwindung von Alpträumen oder zur Veränderung der Persönlichkeitsstruktur. Durch die Erschließung des Traumreiches können unterdrückte Aspekte der Person wieder integriert oder Konflikte zu einer positiven Auflösung geführt werden. Gerade im Dialog mit anderen Traumfiguren kann das Traum-Ich die momentan involvierten Persönlichkeitsdynamiken und ihre Entstehungsgeschichte erkennen (diagnostische Funktion). Das Traum-Ich kann dann durch geeignete Handlungen den Erkenntnisgewinn vertiefen und den Traumverlauf beeinflussen, so daß Veränderungen in der Persönlichkeitsstruktur möglich sind (therapeutische Funktion). THOLEY bietet konkrete Handlungsschemata an, wie mit freundlichen und feindlichen Traumfiguren konstruktiv umgegangen werden kann, um das Innerpsychische besser kennenzulernen. Außerdem führt er auch Beispiele an, bei denen ein mentales Klartraumtraining bei Sportlern zu einer Verfeinerung der sensumotorischen Geschicklichkeit und zu einer Verbesserung der sportlichen Leistungen geführt hat. | ||||||
| Literatur zu Kapitel 4 | ||||||
|
Blackmore S. (1988): A theory of lucid dreams and OBEs. In Gackenbach J., LaBerge S.: Conscious mind, sleeping brain: Perspectives on lucid dreaming. New York Plenum Blackmore S. (1989): Mental models in sleep: Why do we feel more conscious in lucid dreams? Lucidity Letter, 8(2), S.31-46 Castaneda C. (1998): Die Kunst des Träumens. Frankfurt am Main. Fischer Taschenbuch Verlag Hunt H. (1988): The multiplicity of dreams. Lucidity Letter, 7(2), S.5-14 Jung C.G. (1948): Über psychische Energetik und das Wesen der Träume. Zürich Klinger E. (1978): Dimensions of thought and imagery in normal waking states. Journal of altered states of consciousness, 7, S.57-113 LaBerge S., Rheingold H. (1990): Exploring the world of lucid dreaming. New York. Ballantine Price R.F, Cohen D.B. (1988): Lucid dream Induction. In: Gackenbach J. & LaBerge S.: Conscious mind, sleeping brain. Perspectives on lucid dreaming. New York Plenum Press Rechtschaffen A. (1978): The single-mindedness and isolation of dreams. Sleep, 1, S.97-109 Tholey P. (1980): Klarträume als Gegenstand empirischer Untersuchungen. Gestalt Theory, 2, S. 175-191 Tholey P. (1997): Schöpferisch Träumen - wie sie im Schlaf das Leben meistern. 3. Auflage. Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz | ||||||
|